B
Bend
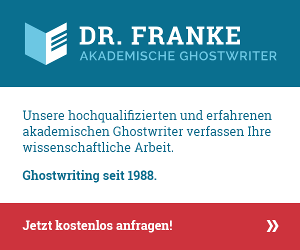
Arbeitsrecht (Direktionsrecht)
Warum ein arbeitgeberseitiges Direktionsrechts (auch Weisungsrecht genannt) ?
Es ist eine Besonderheit von Arbeitsverhältnissen, dass Zeit, Art und Ort der Arbeitsleistung bei Vertragsschluss im Einzelnen noch gar nicht festgelegt werden können, sondern während seines Bestehens fortlaufend durch Einzelweisungen des Arbeitgebers entsprechend den wechselnden Bedürfnissen konkretisiert werden müssen. Diese Konkretisierung der Vertragspflichten durch Ausübung des Weisungs- oder Direktionsrechts ist für Arbeitsverhältnisse typisch. Dem Arbeitgeber wird regelmäßig ausdrücklich oder stillschweigend die Kompetenz zur einseitigen Gestaltung der Arbeitsbedingungen eingeräumt.
Grenzen des Direktionsrechts
Der Arbeitgeber ist dabei in seiner Bestimmung nicht völlig frei. Grenzen erfährt die Ausübung des Direktionsrechts über den Arbeitsvertrag, das Gesetz, Tarifverträge und ggf. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats (z.B. bei Zuweisung neuer oder Entzug bisher übertragener Aufgaben, bei Veränderungen von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie bei Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage -§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG).
Die wichtigste Grenze für das Direktionsrecht bilden die Regelungen im Arbeitsvertrag. Je enger eine Arbeitsaufgabe beschrieben ist, desto enger ist das Direktionsrecht. Durch einen langjährigen Einsatz auf einem bestimmten Arbeitsplatz kann sich die Arbeitspflicht auf diese Tätigkeit in jederlei Hinsicht (inhaltlich, örtlich und zeitlich) konkretisieren. Dies kann dann trotz allgemeiner Aufgabenumschreibung im Arbeitsvertrag die Folge haben, dass ein anderer Arbeitsplatz nicht mehr in Ausübung des Direktionsrecht zugewiesen werden kann.
Eine besondere wichtige gesetzliche Grenze des Direktionsrechts beinhaltet § 315 BGB. Diese gesetzliche Schranke des Direktionsrechts beinhaltet, dass jede Weisung nach billigem Ermessen erfolgen muss. D. h., die Interessen des Arbeitnehmers einerseits und die betrieblichen Interessen andererseits sind gegeneinander abzuwägen. Beispielsweise die Versetzung eines Mitarbeiters an einen anderen Arbeitsort wird trotz entsprechender Versetzungsklausel nur dann zulässig sein, wenn hierfür ein betriebliches Bedürfnis besteht und anerkennenswerte persönliche Belange (Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen etc.) dem nicht entgegenstehen.
Folgen bei Nichtbeachtung der Weisung
Der Arbeitnehmer darf die Befolgung der Weisung verweigern, wenn diese gegen seinen Arbeitsvertrag, ein gesetzliches Verbot, die Grundsätze billigen Ermessens nach § 315 BGB verstößt oder auch wenn der Betriebsrat nicht beteiligt wurde. Eine darauf beruhende Arbeitsverweigerung ist nicht rechtswidrig und berechtigt den Arbeitgeber nicht zur Erteilung einer Abmahnung oder gar zum Ausspruch einer Kündigung. Der Arbeitnehmer behält auch seinen Lohnanspruch, wenn die Weisung rechtswidrig war; der Arbeitgeber befindet sich in einem derartigen Falle in Annahmeverzug nach § 615 BGB.
Missachtet der Arbeitnehmer hingegen eine rechtmäßige Weisung, so verliert er bei entsprechender Arbeitsverweigerung seinen Lohnanspruch, er kann abgemahnt oder gar verhaltensbedingt gekündigt werden. Schließlich drohen dem Arbeitnehmer Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers.
Warum ein arbeitgeberseitiges Direktionsrechts (auch Weisungsrecht genannt) ?
Es ist eine Besonderheit von Arbeitsverhältnissen, dass Zeit, Art und Ort der Arbeitsleistung bei Vertragsschluss im Einzelnen noch gar nicht festgelegt werden können, sondern während seines Bestehens fortlaufend durch Einzelweisungen des Arbeitgebers entsprechend den wechselnden Bedürfnissen konkretisiert werden müssen. Diese Konkretisierung der Vertragspflichten durch Ausübung des Weisungs- oder Direktionsrechts ist für Arbeitsverhältnisse typisch. Dem Arbeitgeber wird regelmäßig ausdrücklich oder stillschweigend die Kompetenz zur einseitigen Gestaltung der Arbeitsbedingungen eingeräumt.
Grenzen des Direktionsrechts
Der Arbeitgeber ist dabei in seiner Bestimmung nicht völlig frei. Grenzen erfährt die Ausübung des Direktionsrechts über den Arbeitsvertrag, das Gesetz, Tarifverträge und ggf. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats (z.B. bei Zuweisung neuer oder Entzug bisher übertragener Aufgaben, bei Veränderungen von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie bei Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage -§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG).
Die wichtigste Grenze für das Direktionsrecht bilden die Regelungen im Arbeitsvertrag. Je enger eine Arbeitsaufgabe beschrieben ist, desto enger ist das Direktionsrecht. Durch einen langjährigen Einsatz auf einem bestimmten Arbeitsplatz kann sich die Arbeitspflicht auf diese Tätigkeit in jederlei Hinsicht (inhaltlich, örtlich und zeitlich) konkretisieren. Dies kann dann trotz allgemeiner Aufgabenumschreibung im Arbeitsvertrag die Folge haben, dass ein anderer Arbeitsplatz nicht mehr in Ausübung des Direktionsrecht zugewiesen werden kann.
Eine besondere wichtige gesetzliche Grenze des Direktionsrechts beinhaltet § 315 BGB. Diese gesetzliche Schranke des Direktionsrechts beinhaltet, dass jede Weisung nach billigem Ermessen erfolgen muss. D. h., die Interessen des Arbeitnehmers einerseits und die betrieblichen Interessen andererseits sind gegeneinander abzuwägen. Beispielsweise die Versetzung eines Mitarbeiters an einen anderen Arbeitsort wird trotz entsprechender Versetzungsklausel nur dann zulässig sein, wenn hierfür ein betriebliches Bedürfnis besteht und anerkennenswerte persönliche Belange (Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen etc.) dem nicht entgegenstehen.
Folgen bei Nichtbeachtung der Weisung
Der Arbeitnehmer darf die Befolgung der Weisung verweigern, wenn diese gegen seinen Arbeitsvertrag, ein gesetzliches Verbot, die Grundsätze billigen Ermessens nach § 315 BGB verstößt oder auch wenn der Betriebsrat nicht beteiligt wurde. Eine darauf beruhende Arbeitsverweigerung ist nicht rechtswidrig und berechtigt den Arbeitgeber nicht zur Erteilung einer Abmahnung oder gar zum Ausspruch einer Kündigung. Der Arbeitnehmer behält auch seinen Lohnanspruch, wenn die Weisung rechtswidrig war; der Arbeitgeber befindet sich in einem derartigen Falle in Annahmeverzug nach § 615 BGB.
Missachtet der Arbeitnehmer hingegen eine rechtmäßige Weisung, so verliert er bei entsprechender Arbeitsverweigerung seinen Lohnanspruch, er kann abgemahnt oder gar verhaltensbedingt gekündigt werden. Schließlich drohen dem Arbeitnehmer Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers.
