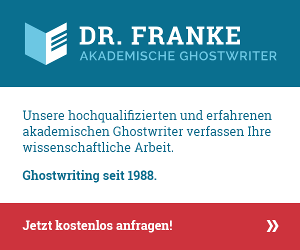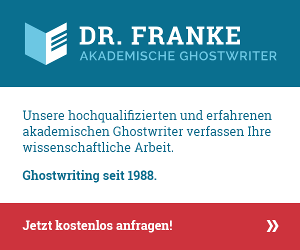
Also zunaechst mal sind deine Berechnungen falsch. p13 ist das Element der Produktionskoeffizientenmatrix. p13 ist in diesem Falle Zeile 1, Spalte 3 = 0,3. q3 betraegt 150. Daraus folgert: 0,3 * 150 = 45. Das ist die Menge von q1 die in die Prokuktion von q3 fliesst. So jedenfalls duerfte der Pfeil zu interpretieren sein der von q1 zu q3 geht und mit der entsprechenden Bezeichnung p13*q3 versehen ist. Wenn du nun auf diese Weise alle "Pfeile" ausrechnest, wirst du sehen das von den zwei Pfeilen zwischen die jeweils zwischen 2 "q"s sind immer nur einen reellen Materialfluss darstellt, da der andere immer 0 ergibt. Der andere Pfeil zB. zwischen q3 und q1 traegt die Bezeichnunh p31*q1. p 3.zeile/1.spalte= 0. Die Pfeile die dort im Diagramm sind bedeuten eigentlich nichts anderes als moegliche Wechselbeziehungen zwischen den jeweiligen Produkten. Theoretisch ist es moeglich das jedes Produkt von jedem anderen eine gewisse Menge benoetigt um hergestellt zu werden. Das Diagramm ist dann eigentlich recht einfach zu verstehen. Stell dir vor von q1 werden zB 100 Einheiten produziert. Davon werden zB 25 Einheiten benoetigt um q3 herstellen zu koennen. Der Rest fliesst direkt in den Verkauf. q1 benoetigt in diesem Falle aber Einheiten von q2 um hergestellt werden zu koennen. Und so weiter und so fort. Jedes Produkt gibt Einheiten an ein anderes ab fuer dessen Produktion, der Rest geht in den Verkauf. Wenn du schon den Gozintograph hattest erkennst du ein paar Parallelen. Nur sind es hier halt 3 Endprodukte.
So, nun nochmal kurz zum Ergebnis des Beispiels.
Auf Seite 81 oben siehst du die Berechnung. Fuer den Verkauf ergeben sich Mengen von y1= 55, y2=50 und y3=150. Die Berechnung ist leicht nach zu vollziehn. Wenn du die jeweiligen Produkte im Diagramm an die Pfeile schreibst kannst du das auch dort ablesen. Du siehst dann zum Beispiel, das die von q3 ausgehenden Pfeile alle einen Wert von 0 haben. Das bedeutet, die Produktionsmenge von q3 geht komplett in den Verkauf (150). q1 hat eine Produktionsmenge von 100. Jetzt muessen wir schauen wie viel hiervon in die Produktion eines anderen Produktes fliesst. Nur ein von q1 ausgehender Pfeil hat einen Wert ungleich 0, naemlich der Pfeil der zu q3 hinfuehrt, hier 0,3 * 150 = 45. Diese Menge muessen wir von 100 abziehen und kommen auf 55 Einheiten von q1 die in den Verkauf fliessen. Selbiges machen wir nun fuer q2. Produktionsmenge: 200. Beide von q2 ausgehenden ergeben einen Wert ungleich 0. Beide Male 75. Ergibt zusammen 150 Einheiten von q2 die in die Produktion von q1 und q3 fliessen. Dies ziehen wir von der Gesamtproduktionsmenge von q2, naemlich 200, ab und erhalten 50 Einheiten von q2 die in den Verkauf fliessen.
So, ich hoffe ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen 🙂.
Frohe Weihnachten 🙂,
Stefan